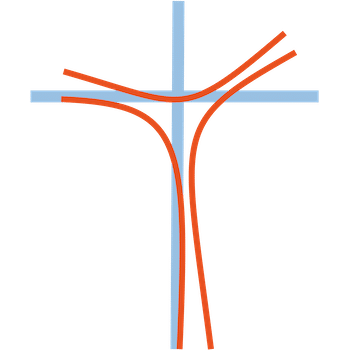Predigt am 2. Adventssonntag
St. Canisius-Gemeinde, Berlin, 4. Dezember 2022
Dr. Peter Frey

Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren,
liebe St. Canisius-Gemeinde,
Guten Abend!
Journalist bleibt man auch nach seiner Pensionierung und deshalb habe ich Pfarrer Hösl auch gerne zugesagt, heute Abend über das Thema „Medien und Kirche“ zu sprechen. Ich will aber gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ratschläge zur Kommunikation zu geben, ist ja immer schwierig. Besonders schwierig ist es, wenn die Situation, aus der heraus eine Person oder Institution kommuniziert, verfahren ist. Und das ist sie bei der Katholischen Kirche. Da ist erfolgversprechende Kommunikationsarbeit schwierig, wenn nicht unmöglich. Denn das Wichtigste beim Thema Kommunikation ist: die Substanz muss stimmen. Sonst gerät Kommunikation leicht in die Nähe von Public Relations.
Aber wir befinden uns ja im Advent. Der Jahreszeit im Kirchenjahr, die mir besonders viel sagt, mit ihrer Botschaft der Sehnsucht, der Erwartung, aber eben auch – wie wir eben im Evangelium über Johannes den Täufer gehört haben – der Bereitschaft bzw. der Forderung zur Umkehr. „Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen“, heißt es da. Klarer kann man das nicht sagen. Die Botschaft, die der Evangelist Matthäus hier wiedergibt, ist eine Botschaft an die religiöse Elite, Pharisäer und Sadduzäer. Kehrt um! Kehr um, Kirche!
Aber ich will beim Thema bleiben. Immer wieder Umkehr zu fordern – so könnte man ja auch die Aufgabe von Journalisten beschreiben. Ich weiß, das klingt dieser Tage leicht arrogant. Das könnte, noch dazu am Lietzensee in unmittelbarer Nähe des RBB-Funkhauses in der Masurenallee, verständlicherweise Widerspruch auslösen. Natürlich: wer aus der Wüste ruft, der sollte selbst ein Büßergewand tragen und nicht Prunkgewänder und Privilegien für sich beanspruchen. Das gilt selbstverständlich auch für meine Zunft. Und dennoch bestehe ich darauf, dass wir Journalisten genau diese Aufgabe haben. Immer wieder, mit unbequemen Fakten, unliebsamen Perspektiven und zu Widerspruch anregenden Meinungen zur Umkehr aufzufordern.
Ich habe das Wort „Medien“ bisher vermieden. Weil es heutzutage in den Medien zu viele Stimmen gibt, die eben nicht nach journalistischen Kriterien arbeiten, sondern deren Ziel es ist, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, mit ihren Bauchgefühlen, mit Anscheinsbehauptungen oder scheinbar modern und offensiv als „Influencer“, als „Beeinflusser“. Da spielen Fakten keine oder jedenfalls nicht die Hauptrolle, sondern Stimmungen, Werbeanliegen, politische Botschaften oder allzustarke Egos. Nein, diese Art von „was mit Medien“ ist kein Journalismus. Im Gegenteil: diese neuen Medien machen es uns schwer, weil die Grenzen natürlich fließend und für einen Nicht-Fachmann oft gar nicht zu erkennen sind. Wenn ich von Journalismus als Beruf spreche, dann spreche ich von der Forderung nach Berichterstattung im Sinn einer „Wahrheitserzählung“. Im Journalismus geht es um Kritik, Aufklärung und Distanz. Kritik bedeutet – Unterschiede erkennen, Distanz zum Objekt der Beobachtung einlegen, den Lesern, Zuschauerinnen, Usern die Möglichkeit zu geben, einen Sachverhalt, aber natürlich auch Personen mit klarem Blick zu betrachten. Selbstverständlich gibt es neben Kritik im Journalismus auch Raum für Empathie – vor allem im Genre der Reportage, wenn man Menschen öffnen oder von ihrem Leid, ihren Begrenzungen, ihrer Verletzlichkeit erzählen will.
In der Lesung aus dem Römerbrief heute ist von der „Wahrhaftigkeit Gottes“ die Rede. Eine interessante Wendung für einen Journalisten. Ich bin zu wenig Theologe, um zu entscheiden, ob Paulus, wenn er das Wort benutzt, von dem spricht, was ich höre. Jedenfalls: Wahrhaftigkeit ist nicht nur eine göttliche, sie ist auch eine menschliche und eine journalistische Tugend. Dabei gehört „Truth“ – Wahrheit – zu den umstrittensten Begriffen aus den Kulturkämpfen der heutigen Tage. Donald Trump nennt seine eigene Social-Media-Plattform genauso. Mit klarer Absicht. Denn es gehört zum Grundbestand des Arsenals von Populisten, die Lüge zur Wahrheit zu erklären und die Menschen dadurch zu verwirren. So gesehen ist ein Anschlag auf die Wahrhaftigkeit auch ein Anschlag auf die Menschen. Sind wir doch auf Wahrheit, Vertrauen, eine gemeinsame Faktenbasis angewiesen, wenn wir gut kommunizieren und zusammenleben wollen. „Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen“, so beschreibt Jesaja das Wirken eines gerechten Herrn im Dienst der Geringen und Armen. Da „Wahrheit“ keine materielle Komponente ist, sondern ein ideelles Gut, dessen wir alle bedürfen, dürfen, ja müssen wir uns auch als „gering“ und „arm“ fühlen, wenn uns die Wahrheit vorenthalten wird. Wir können uns aber selbst ermächtigen, selbst etwas tun, einen Anspruch auf Wahrheit erheben und lernen, Wahrheit von behaupteter Wahrheit zu unterscheiden. Dazu brauchen wir Wegweiser, Aufklärer.
Dazu können auch Journalisten gehören, neben vielen anderen: Lehrern, Schriftstellern, Priestern. Ich nenne gleich einen Namen, der für mich sehr wichtig war. Zunächst noch einmal zum Journalismus. Für mich ist er professionelle Suche nach Wahrheit. Diese Suche muss im Bewusstsein unternommen werden, dass es in einer so kompliziert gewordenen, vielschichtigen Welt die EINE Wahrheit oft nicht gibt. Sondern, dass sie zusammengetragen werden muss, aus unterschiedlichen Perspektiven. Wahrheit entsteht auch durch Verständigung. Deshalb müssen Journalisten angesichts der Komplexitäten der heutigen Zeit ihre Berichte, ihre Reportagen, ihre Kommentare und Interviews an mündige Bürgerinnen und Bürger quasi übergeben – an ein Publikum, das dann frei sein muss, daraus zu machen, was es für richtig hält. Gute Journalisten müssen die Mündigkeit der Empfänger respektieren. Denn die Menschen sind nicht dumm, Gott-sei-Dank. Wir müssen ihnen den Freiraum lassen, die Wahrheit zu buchstabieren – für sich alleine und in den Gruppen, in denen sie sich bewegen. Das ist auch eine Frage des Vertrauens. Nicht nur in Journalisten, sondern auch von Journalisten.
Ich war schon als junger Mann fasziniert von einem Ausspruch der Schriftstellerin Anna Seghers – die in Mainz, meiner Heimat, geboren wurde und dann als Zeugin eines verheerenden Jahrhunderts in Berlin lebte und starb. Anna Seghers hat einmal geschrieben: „Wer auf Menschen einwirken will, muss von den Menschen, an die er sich wendet, verstanden werden. Es gibt keinen Befehl in der Kunst: Du musst mich verstehen. Ich muss als Künstler die Mittel finden, um mich verständlich zu machen“. Das Zitat begleitete mich ein Berufsleben lang handschriftlich in meinem Büro.
So ist es auch im Journalismus: es gibt keinen Befehl. Aber ja, wir müssen die Mittel finden, verstanden zu werden. Wir wollen ja mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten zu Aufklärung, zum Zusammenleben, zu Gemeinschaft, zum Fortschritt, zur Verständigung. Manchmal übrigens ist es frustrierend, dass es den Befehl nicht gibt. Den Befehl, nun endlich den Klimawandel entschieden zu bekämpfen. Den Befehl, nun endlich die Weltwirtschaftsordnung zu Gunsten des Südens zu verändern. Niemand konnte befehlen, dass wir schon 2014 den Charakter des Putin-Regimes erkannten, obwohl viele Fakten auf dem Tisch lagen. „Bringt Frucht hervor, die Eure Umkehr zeigt“, predigt schon Johannes der Täufer. Mit so hohem Anspruch dürfen Journalisten freilich gegenüber ihrem Publikum gar nicht auftreten. Aber wir müssen uns schon fragen, ob wir mit unserer Kritik, mit unserer Berichterstattung, z.B. aus vom Klimawandel betroffenen Regionen, mit unseren Argumenten eindringlich genug waren, oder ob wir uns der schnellen Schlagzeilen wegen von wichtigerem haben abbringen lassen.
Ein zweiter Spruch, der mich begleitet hat, mehr als Chef denn als Redakteur, lautet: „Man soll die Menschen nach ihrer günstigen Seite betrachten“ – eine Weisheit aus dem Talmud. Aus dem ersten Abschnitt der Mishna Avuot, 6. Vers, wörtlich: „beurteile jeden Menschen nach der guten Seite“. Ich verstehe schon: das passt so gar nicht zur kritischen Annäherung, die ich eben für uns Journalisten in Anspruch genommen habe. Aber ich habe ja hinzugefügt: Empathie gehört auch dazu. Wenn man das auf die Kirche anwendet, dann könnte man sagen: der Beschluss der deutschen Bischofskonferenz, nun endlich keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen mehr zu ziehen, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschieden sind oder gleichgeschlechtlich zusammenleben – das ist doch schon ein Stück Umkehr. Ist es. Ich bin dankbar, dass diese Entscheidung gefallen ist.
Wenn ich aber nicht mit dem Auge von Empathie und Erbarmen, sondern dem Auge der Kritik und Unterscheidung darauf schaue, dann ändert sich die Richtung. Dann fallen dem Journalisten Fragen ein: wenn Sie sich, verehrte Bischöfe, schon dazu durchringen, endlich und zu spät, das Arbeitsrecht zu ändern, warum schließen Sie wiederverheiratete Geschiedene noch immer von der Kommunion aus? Und natürlich bleibt die Frage, wann die Kirche die Kraft der Entschiedenheit und Klarheit findet, aus den jammervoll vielen Missbrauchs-Fällen der letzten Jahrzehnte Konsequenzen zu ziehen. Da geht es um die Täter, aber auch um diejenigen, die um den Ruf der Kirche besorgter gewesen sind als um die Opfer. Sie müssen zu Rechenschaft gezogen und auch aus höchsten kirchlichen Ämtern entfernt werden.
Gewiss, in der Kirche geschieht viel Gutes. Immer noch ist sie – sind wir – eine Hefe, die Mitmenschlichkeit in eine immer konkurrenzorientiertere, kalte, digitale, vereinzelnde Gesellschaft streut. Die eine Kultur des Miteinanders und der Integration vertritt, in einer immer mehr von Polarisierung und Häme geprägten Welt. Ja, unser christlicher Glaube hat viel zu bieten. Aber, solange das Erscheinungsbild der Institution so ist, wie wir das nun schon seit Jahrzehnten erleben, sollten wir nicht auf gute Medienberichte hoffen. Johannes kündigt im heutigen Evangelium den an, der „die Schaufel in der Hand hat hält und seine Tenne reinigen wird“. Das müssen wir – unsere Tenne reinigen – und das ist auch die Aufgabe der Beobachter von außen, ohne die so vieles gar nicht aufgedeckt worden wäre.
Dieses strenge Wort soll heute aber nicht das letzte Wort sein. Nicht an einem Sonntag mit der großartigen Vision des Jesaia, der einen jungen Trieb besingt und die betörendste Vision beschreibt, die das Alte Testament zu bieten hat: „der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein“. Eine andere Welt ist möglich. Sie ist es. Und manchmal hat man sie sogar selbst erlebt. Auch in der Kirche.
Ich möchte deshalb am Schluss an einen Priester und Prediger erinnern, der wenige Kilometer von hier Sonntag für Sonntag viele Menschen anzog. Pater Josef Schulte, langjähriger Pfarrer in St. Ludwig in Wilmersdorf, der am vorvergangenen Freitag verstorben ist, nach kurzer schwerer Erkrankung. Josef wurde für mich und viele andere ein später Vater, ein Bewahrer meines Glaubens. Seine Predigten waren im wahrsten Sinn des Wortes An-Sprachen. Worte, die die Menschen berührten. Er donnerte und wütete nicht, oftmals sprach er losgelöst vom Tagesevangelium über die Fragen von heute. Er verstand es, seiner Gemeinde Zu-Spruch zu geben.
Ein Westfale, der seit fast drei Jahrzehnten in Berlin lebte und die Stadt liebte, wand sich den Menschen in seiner Gemeinde zu, den modernen, zweifelnden, gestressten Berlinern. Paulus spricht heute vom Trost-Spenden. Das klingt furchtbar altertümlich – aber brauchen wir häufig genug nicht vor allem das: Trost? Oft zitierte Pater Josef aus dem reichen Literaturschatz, den er sich im Lauf seines Lebens als Leser erworben hatte. Hier ein Satz Thomas von Aquin und dort ein Zitat aus dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld, den er besonders verehrte. Niemals ging es darum, Bildung zu demonstrieren. Er zeigte Spuren auf, auch aus der Welt von heute, das Leben auch in seinen Widersprüchen besser zu verstehen und es annehmen zu lernen. Natürlich berührte es mich besonders, dass er sich auch als Leser von Tages- und Wochen-Zeitungen outete, mal FAZ, mal Zeit, mal Süddeutsche zitierte und auf Formulierung hinwies, in denen für ihn mehr als Tagesjournalismus drinsteckte. Ein Mann, der auch mal mit Worten von Journalisten den Weg zum Himmel wies.
Pater Josef Schulte war ein Prediger von heute. Ein Kirchen-Mann, auf dessen Wort man sich freute, mit dem man lebte und von dem man zehrte. Man könnte sagen: er war ein Medium, das auf wichtigeres hinwies. Nun doch zurück zum Thema „Kirche und Kommunikation“. Die Kommunikation der Kirche gelingt, wenn sie im Dienst anderer und nicht von sich selbst steht. Sie muss sich der Wahrheit stellen. Sie muss Menschen hervorbringen, die das Talent, den Mut und die Glaubwürdigkeit erringen, dies zu tun: in Demut, Bescheidenheit und dem daraus wachsenden Selbstbewusstsein.
Pater Josef war ein Medium, das in diesem Sinn für die Kirche sprach. Ohne ihn ist Berlin, ist der Ludwigkirchplatz nicht mehr das, was er war.
Amen