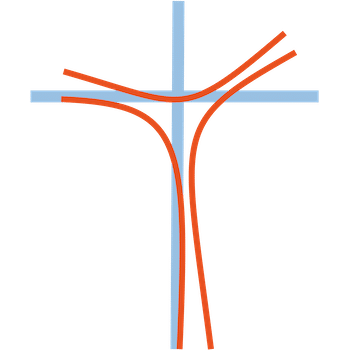Zweitausend Jahre nachdem der Mann in der Bibel seinem Knecht den Schlüssel für sein Haus gegeben hatte, weil er . auf Reisen gehen wollte, kam er schon wieder in so eine Situation, Er musste für länger, vielleicht auch für immer verreisen. Gott sei Dank hatte er aber zwischenzeitlich den großen Philosophen Karl Marx gelesen, der im Übrigen nicht die Religionen abgelehnt hatte, und der Mann folgte seinem kategorischen Imperativ, also dem unbedingten Gebot, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. Er wollte unter sich keine Knechte und keine Mägde sehen und gab daher mir die Schlüssel für sein Haus.
Zwölf Zimmer hat dieses. Wer wird darin wohnen?

In das erste Zimmer kommt Petrus, er begegnete mit bei einer Literaturwerkstatt für psychisch kranke Kinder. Seine Mama schrieb ihm einen Brief, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun habe wolle. Er solle es nicht so schwernehmen, er sei ja schließlich schon zwölf und fast erwachsen und außerdem ein Junge, stark wie ein Indianer. Jeden Morgen lief der Junge los, um zu schauen, ob seine Mama vielleicht doch noch einen Brief geschrieben hatte. Vielleicht, dass der erste Brief eine Versehen war? Eine Entschuldigung? Einen Brief, in dem stand, dass sie ihn lieben würde? Jeden Tag schrieb der Junge in meiner Gruppe romantische Sätze für seine Mutter wie einen solchen: Ich werde für meine Mama die Sterne zum Leuchten bringen. Ob die Mama je diese Zeilen gelesen hat?
Im zweiten Zimmer wohnt dann Andrea. Sie floh mit vierzehn alleine von Eritrea nach Deutschland. In unserer Literaturwerkstatt erzählte sie immer wieder ihre Fluchtgeschichte. „Ich habe meinem Vater Tschüss, bis gleich gesagt und dann bin ich gegangen. Später war ich dann in Deutschland.“ Ende, mehr sagte sie nicht. Sie brachte der Gruppe immer etwas selbst gekochtes Eritreisches Essen mit. Wenn die Gruppe sich bedankte, lächelte sie mit einer solchen Traurigkeit, dass ich dachte, ich müsste daran zerbrechen. Nach der Literaturwerkstatt wollte sie bei mir bleiben. Ich brachte ihr an einigen Nachmittagen Fahrradfahren bei. Zum Abschied schrieb sie mir: Danke für die Literatur, aber vor allen Dingen, dass du mir Fahrradfahren beigebracht hast. So werde ich bei meiner nächsten Flucht viel schneller sein.
Das Zimmer Nummer drei bekommt Johanna. Ich lernte sie nachts 2009 in einer Kleinstadt kennen. Zu der Zeit ging ich am späten Abend immer spazieren, um über die Literaturwerkstatt am Tage nachzudenken. Johanna zog mit ihrem Hackenporsche und mit ihrem Hund durch die Straßen und durchsuchte die Mülleimer nach Pfandflaschen. Das Geld, welches ich ihr geben wollte, lehnte sie entrüstet ab. Sie sei immer für ihr Geld arbeiten gegangen. Geschenkt habe ihr nie jemand was. Das sah man ihr an. Sie, lange vor dem zweiten Weltkrieg geboren, lebte bei gewalttätigen Eltern, es gab für sie keine Fluchtmöglichkeiten und so sitzt sie jetzt ihre Armutsrente in einer kleinen Wohnung in der Provinz ab. Solange sie kämpfen musste, dachte sie nicht nach, blieb sie von Depressionen verschont. Ihr erster Mann blieb im Krieg, so sagte man das damals, und sie redete nicht weiter darüber. Der zweite Mann brachte sich um, da waren die Kinder klein. Sie musste da sein, sie wollte da sein und sie brachte die Kinder alleine durch. Ihr Körper ist kaputt von der harten Arbeit. Für Freunde fehlte stets die Zeit. Sie fühlt sich allein, sagt sie. Nein, das ist kein Gefühl, sie ist allein. Sie fühlt sich erstarrt, weil sie ihr Leben als komplett verpfuscht sieht. Sie, die Kämpferin, hat jeglichen Lebensmut verloren. Und jedes Wort der Hoffnung und der Aufmunterung empfindet sie als Hohn. Wie alt mag sie wohl gewesen sein? Schwer zu sagen. In einem Lied, Jojo heißt es, hat BAP, als man diese Band noch hören konnte, diese Art von Damen mal in der ersten Strophe besungen. Ich will es jetzt nicht vorlesen, da ich denke, dass die Kölschkenntnisse hier nicht so vorhanden sind.
(Ich weiß nimieh wo, nur noch wie se do jing
Die verbiesterte Ahl met dämm Hung ahn der Ling
Zum Krüppel jemästet, wie en Karikatur
Ne Jojo, dä belle kann, ahn ner Schnur
Die die ahl Frau nit losslöht, op jarkeine Fall
Ihr läuf keiner mieh fott, wie die andere all
Wie dä Mann, wo ihr nur en Schachtel Feldposs vun blevv
Die se usswendisch kann, ävver trotzdämm ophivv
En Sütterlin steht do, wie schön se ens woor
Vüür allem ihr Naas un ihr pechschwazze Hohr
Wie die vun dä Zijeunerin övverm Koppeng
Op dämm Ölbild, dat ihr ens ihr Doochter jeschenkt
Die, die jetz joot verhieroot en Rüsselsheim livv
Met zwei Enkel un jed Johr zum Muttertaach schriev
Wie der Sohn, der sich Johr un Daach nimieh jemeld
Nur dat Dier, sons kei Minsch hätt die Ahl op der Welt
Übersetzung;
Ich weiß nicht mehr wo, nur noch wie sie da ging. Die verbiesterte Alte mit dem Hund an der Leine. Zum Krüppel gemästet wie eine Karikatur, ein Jojo, der bellen kann an einer Schnur, die die alte Frau nicht losläßt auf gar keinen Fall. Ihr läuft keiner mehr fort, wie die anderen alle. Wie der Mann, wo ihr nur eine Schachtel Feldpost von blieb, die sie auswendig kann, aber trotzdem aufhebt. In Sütterlin steht da wie schön sie mal war – vor allem ihre Nase und ihre pechschwarzen Haare, wie die von der Zigeunerin über dem Kopfende auf dem Ölbild, das ihr mal ihre Tochter geschenkt. Die, die jetzt gut verheiratet in Rüsselsheim lebt, mit zwei Enkeln und jedes Jahr zum Muttertag schreibt. Wie der Sohn, der sich Jahr und Tag nicht mehr gemeldet. Nur das Tier, sonst keinen Menschen hat die Alte auf der Welt.)
Philippus wird Zimmer Nummer vier beziehen. „Ich wohne im Heim,“ stellt er sich bei einer Literaturwerkstatt in einer Förderschule mir und den anderen Kindern vor. „Die Erzieher sagen, das heißt nicht Heim, sondern Wohngruppe, und dass sie Betreuer sind und keine Erzieher. Aber ich sage das trotzdem.“ Die anderen Kinder berichten an dem Montag, was sie zu Hause erlebt haben, Philippus erzählt von seinem Vater, der der Chef auf einer Ölplattform ist, ein Schnellboot hat, groß, stark und sehr reich ist und bald kommt, um ihn zu sich zu holen. Die anderen Kinder erzählen, was sie nachmittags so machen, nichts Aufregendes, ein wenig chillen, einkaufen, in den Verein gehen. Philippus erzählt von seinem Trainer, der mit ihm zweimal die Woche alleine trainiert, weil nur er weiß, dass aus dem Jungen ein begnadeter Fußballprofi wird. In den Pausen steht Philippus alleine rum, in der Klasse möchte bei Gruppenarbeiten niemand mit ihm zusammenarbeiten. Alle Kinder sehen sich manchmal nachmittags, nur mit Philippus möchte sich keiner treffen. Die Kinder wollen sich mit mir treffen, aber nicht, wenn Philippus dabei ist. Also geht das ehemalige Heimkind Mirijam nachmittags allein zum See. Auf der Mauer sitzt Philippus und schmeißt Steine ins Wasser. Völlig unpädagogisch drücke ich ihm ein Zuckergetränk in die Hand und werfe auch Steine ins Wasser. Das machen wir in der Woche noch zweimal. Zum Abschied schreibt er auf einen Zettel: Danke, dass du mein Fußballtrainer warst.
Zimmer 5 bezieht Doktor Bartholomäus. Er schrieb mich an, als er einen Artikel von mir in einer Zeitung gelesen hatte.
In Heimen aufgewachsen gründete er eine Familie und war erfolgreich in seinem Job. All das Dunkle hatte er verdrängen können. Dann waren die Kinder aus dem Haus, die Stille kam, der Job lag hinter ihm. Und es packte ihn die Vergangenheit und schmiss ihn zu Boden. Alles war wieder da, aber keiner verstand den ehemaligen Doktor in Rente. Wie kann man sich nach den vielen, vielen Jahren, die doch so erfolgreich waren, von der kurzen Zeit, die im Dunkeln war, einholen lassen? In Wahrheit aber war das Trauma nie weg. Es hat unter dem Bett gelauert, bis endlich die Zeit ohne Ablenkung da war und dann kroch es erbarmungslos hervor, ließ den Menschen verstummen und – ihn seine Angst im Alkohol ertränken.
Doktor Bartholomäus hatte sich seinen Lebensabend bestimmt ganz anders vorgestellt. Und er verachtet sich dafür, dass er, der erfolgreiche Doktor, jetzt in der Rente ein Wrack ist. Er hat seine Gefühle nicht unter Kontrolle, weil die Dämonen aus der Vergangenheit nicht nur unter dem Bett hervorgekrochen, sondern auch durchs offene Fenster hereingeflogen kamen. Seine Schwester, die wie auch er im Heim war, hat sich im Glauben gefangen. Sein kleiner Bruder, den er immer versucht hat zu beschützen, starb in jungen Jahren. Er weiß nicht, ob es Selbstmord oder ein Unfall war. Bis heute plagen ihn Schuldgefühle. Hat er ihn nicht genug beschützt? Aber wer beschützte ihn? Und vor allen Dingen wer schützt ihn jetzt?
Zimmer Nummer 6 gehört Matthäus. Ich lernte ihn in einer Jugendarrestanstalt kennen. Beziehungsweise, was von ihm nach seiner Drogenkarriere noch geblieben war. Erst dachte ich, sie hätten mir einen älteren Mann in meine Gruppe gesetzt, aber die Drogen hatten den 16-Jährigen so altern lassen, dass alle Jugendlichkeit aus seinen Zügen verschwunden war. Auch sein Hirn war angegriffen. Ob er etwas von dem verstanden hat, was ich erzählt habe, weiß ich nicht. Er saß am Tisch und malte jeden Tag das gleiche Bild. Zwischendurch zuckte sein ganzer Körper. Nicht nur einer der Teilnehmer sagte bei diesem Anblick: Ich werde nie in meinem Leben solche scheiß Drogen nehmen. Da hatte sich der Aufenthalt für diese Jugendlichen im Arrest ja schon mal gelohnt. Wenn auch die Abschreckung anders lief, als vom Staat gedacht.
Das Zimmer Nummer sieben bekommt Simone. Sie wohnt in einer betreuten Wohngruppe. Als sie erzählt, dass sie vorher nachts auf der Straße rumgehangen hat, und ich sagte, dass ich das nicht möchte, fragte sie warum. „Weil ich mir dann Sorgen um Dich mache.“ „Musst Du nicht. Um mich hat sich noch nie jemand Sorgen gemacht.“
„Ich habe übrigens auch schon mal in der Zeitung gestanden,“ berichtet sie uns dann voller Stolz.
„Schön, um was ging es denn?“
„Na ja, dass ich bei meiner Geburt die jüngste Großmutter in diesem Bundesland hatte. Die war 28.“ Was soll man dazu bloß sagen? Bevor ich einen dummen inhaltslosen Erwachsenenkommentar von mir gebe, sieht sie mein Dilemma und lacht: „Keine Sorge Mirijam. Ich durchbreche die Kette, ich liebe nämlich keine Jungs.“ Die ganze Woche bespaßt sie die Gruppe, mit ihrem Witz und ihren Geschichten. Am letzten Tag lade ich die Literaturwerkstatt auf ein spätes Frühstück in mein Hotel ein. Simone schwankt zur Türe, gegen 12.30 Uhr, und kotzt auf den Boden. Auch ein Abschiedsgeschenk. Die Hotelinhaber nehmen es mit Humor: Wurde mal Zeit, dass hier die Realität anklopft.
Die Nummer acht habe ich für Thomas reserviert. In einem abgelegten Brennpunktstadtteil soll ich mal wieder die Feuerwehr spielen. Die Obrigkeit hat Angst bekommen, es brannten ein paar Mülltonnen. Nach der Literaturwerkstatt zeigte Thomas mir seinen Wohnort. Die Wohnhäuser sind mit Netzen umgeben, weil die Leute ihren Müll aus den Fenstern schmeißen. Es gibt nur ein einziges Einkaufszentrum, wo er mit seinen Freunden regelmäßig rausgeschmissen wird. Als ich den Ort unserer Abschlusspräsentation nenne, guckt mich die Gruppe ängstlich an. „Wo ist das“, fragt Thomas mich. „Drei Stationen mit der S-Bahn von hier!“ Niemand aus der Gruppe war jemals dort. Man verlässt seinen Stadtteil nicht. So wie es in Köln Kinder in abgehängten Stadtteilen gibt, die noch nie den Kölner Dom gesehen haben. „Mirijam, Du bleibst aber die ganze Zeit bei uns??!“ Ich verspreche es. Mit Thomas gehe ich an dem letzten Nachmittag noch mal spazieren. Er erzählt mir von seiner Angst vor der Zukunft. „Mirijam, was soll nur aus uns werden? Die Erwachsenen hier sagen, lieber drei Jungs im Knast als ein verhurtes Mädchen!“
Das Zimmer Nummer 9 gebe ich Jakob. Am Ende des ersten Tages einer Literaturwerkstatt in einer ostdeutschen Provinz fragte mich Jakob, ob ich am nächsten Nachmittag mit ihm eine Fahrradtour machen könnte. „Klar!“
Am nächsten Tag erscheint er ohne Fahrrad. Ich schlage einen Spaziergang vor. Er erzählt mir wilde Geschichten, von den tausenden Euros die er auf seinem Konto hat und warum er kein Fahrrad dabeihat. Wenn man arm und traurig ist, ist die Phantasie eine Rettung
„Also, ich hatte früher kein Fahrrad, weil ich kein Geld hatte“, oute ich mich.
Es stellt sich raus, dass Jakob aus einer fünfköpfigen Familie kommt, die ein einziges Fahrrad besitzt. Damit muss die Mutter zur Arbeit ein paar Dörfer weiter fahren.
„Deswegen kann ich das Fahrrad nicht haben, auch nicht nach ihrer Arbeit, sie hat Angst, dass es kaputt geht und wir brauchen doch das Geld so dringend.“
Nach unserem Ausflug finde ich heraus, dass es eine Stelle gibt, die gegen eine Spende Fahrräder hergibt. Mit Jakob mache ich mich auf den Weg ins JUZE. Der Sozialarbeiter ist sehr nett, er zeigt uns die gespendeten Fahrräder und der Junge sucht sich eines aus. Der Sozialarbeiter verspricht, das Fahrrad am nächsten Tag mit uns fit zu machen. Ich sage zu, dass ich die Spende übernehme. Am nächsten Tag soll ich mit der zuständigen Leitung absprechen, wie genau ich die Spende übergebe. Jakob dreht zum Abschied schon mal eine Runde mit seinem zukünftigen Fahrrad. Wie abgesprochen rufen wir am nächsten Tag an. Ich informiere die Dame am Telefon darüber, dass der Beschenkte zuhöre. Sie hält mir einen langen Vortrag, dass ich das Fahrrad nicht erwerben dürfte. Das dürften nur die Erziehungsberechtigten machen. Ich weise sie darauf hin, dass Jakobs Eltern berufstätig seien und es nicht zu den Öffnungszeiten des JUZE schaffen würden. Am Wochenende hat das JUZE zu. Dann solle Jakob halt warten, bis seine Eltern Urlaub hätten. Schließlich willigt die Dame doch noch ein, dass ich das Rad für den Jungen holen kann. Jakob freut sich. Schon auf dem Hof des JUZE kommt uns die Dame wild gestikulierend entgegen. Das ginge nicht mit dem Fahrrad, ich dürfte das nicht. Jakob wird kreidebleich und setzt sich. Die Dame redet wie ein Wasserfall, ihr männlicher Kollege, der uns am Vortrag zugesichert hatte, dass wir das Fahrrad bekommen, steht daneben und schweigt. Ich unterbreche sie und verabschiede mich, Jakob bleibt mit Tränen in den Augen bei mir. Mit dem Jungen klappere ich alle Läden in dem Nest ab, welche gebrauchte Fahrräder verkaufen. Ein Einziges finden wir. Ich rufe meinen besten Freund in Köln an und frage ihn, ob ich sie noch alle habe. Er bejaht. Ich kaufe das Fahrrad. Stolz wie Oskar zeigt Jakob es einem Sozialpädagogen, an dem Ort, wo ich meine Literaturwerkstatt anbiete.
„Ich wünsche Dir viel Spaß, in der kurzen Zeit, in der Du das Fahrrad haben wirst.“
Dem Junge fällt alle Freude aus dem Gesicht. „Warum?“
„Weil es Dir eh geklaut wird.“
Erwachsene können solche Arschlöcher sein.
Thaddäus wird in der Nummer 10 wohnen. Ich lernte ihn in meinen Anfangsjahren im Jugendgefängnis kennen. Er wohnte bei seiner psychisch kranken Mutter, die ihn häufiger vergaß und alleine ließ. Vor lauter Hunger aß er die Tapete von den Wänden. Einmal versuchte die Mutter ihn in die Waschmaschine zu stecken.
„Ein Jugendamt ist bei uns nie vorbeigekommen“, erzählte er mir. Ich bin abgehauen. Sie haben mich dann in Einrichtungen gesteckt, aus denen ich immer wieder verschwunden bin.“ Und dann sagt er einen Satz, den ich so oft in meinen Literaturwerkstätten zu hören bekomme und der einen Zustand beschreibt, der angeblich in Deutschland nicht existiert: „Ich bin dann irgendwie im System verloren gegangen.“ Und dann war Thaddäus jahrelang auf der Straße. Irgendwann wurde er so kriminell, dass er ins Gefängnis musste. „Gott sei Dank musste ich in den Knast, sonst wäre ich heute tot.“
Die Nummer elf gebe ich Jakobus. Ich lernte ihn im Kloster Himmerod bei meiner Literaturwerkstatt für unbegleitete junge Menschen kennen. Er hatte das große Glück, am vorletzten Tag vom örtlichen Bäcker, der vor dem Kloster seinen Laden betrieb, eine Lehrstelle angeboten zu bekommen. Die Gasthoffamilie gegenüber bot dem Jungen ein Zimmer an. Perfekte Integration für einen Jugendlichen aus einem fernen Land. Losgehen sollte es mit einem Praktikum. Nach Ende der Literaturwoche fuhr der Junge in sein Heim und sollte in der Woche drauf wiederkommen.
Zwei Tage später bekomme ich einen Anruf des Heims. Der Fall sei nicht für eine Bäckerausbildung vorgesehen. Sie im Heim würden alles regeln. Der Junge ist tieftraurig und bleibt im Heim. Keine Ausländerbehörde, kein böses Gesetz hat den Traum des Jungen zerstört, sondern eine Heimleitung, die nicht auf das Geld für den Jungen verzichten wollte.
18 Monate später stand der Junge, der jetzt im zweiten Lehrjahr wäre und sein eigenes Geld verdienen würde, vor der Abschiebung. Der Junge weint am Telefon, wir haben die ganze Zeit Kontakt gehalten.
Ich bettle Geld bei der Kölner Kampagne „kein Mensch ist illegal“ zusammen, besorge davon einen Anwalt für den Jungen und wir verhindern die Abschiebung.
Das Zimmer 12 wird nie bezogen werden. Dieser Junge wurde vom Lebensanfang an verraten. Ich habe ihn nie kennengelernt und doch hat er mich und meine Literaturwerkstätten auf immer geprägt.
Hermann Heibach wird am 7. März 1986 geboren. Die Mutter trennt sich bald von seinem Vater. Mit drei Kindern zieht sie zu Verwandten. Bald ist die Mutter überfordert und will das Sorgerecht dem Vater geben, was auch klappt. Der Vater missbraucht daraufhin seine Stieftochter über Jahre. Es gibt eine Anzeige. Der Mann muss für dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Hermanns Mutter bekommt eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren. Jetzt übernimmt das Jugendamt. Hermann kommt in ein Heim,
Lange bleibt der Junge dort nicht. Es gibt immer wieder Ärger. Hermann kommt in ein Heim nach Münster. Dann in ein sogenanntes Resozialisierungscamp in Andalusien. Warum auch immer? Vielleicht sollte man Menschen erst mal sozialisieren.
Mit 17 läuft das Programm für ihn aus. Er muss zurück ins Heim nach Münster. Dann zieht er zieht zum Vater, der ihn bald rausschmeißt. Er wohnt in Kellern und in Zelten.
Bei der Polizei ist er bald als Kleinkrimineller bekannt. Er trägt jetzt schwarze Klamotten. Findet er gut, er gehört jetzt zu einer Szene. In einem Laden nimmt er Schnaps mit. Den Ladenbesitzer bedroht er mit einem Messer. Das nennt man bewaffneten Raub. Hermann wird gefasst. Er erhält Bewährung. Die Sozialstunden schafft er nicht. Der Amtsrichter stellt einen Haftbefehl aus.
Hermanns Leben in Freiheit endet Anfang Oktober auf der Suche nach einem WC. Am Kölner Hauptbahnhof fragt er Polizisten nach dem Abort. Es ist spät nachts und Hermanns Outfit zu auffällig. Die Beamten überprüfen seinen Ausweis und nehmen ihn sofort fest. Hermann kommt ins Gefängnis nach Köln-Ossendorf, zwei Wochen später wird er nach Siegburg verlegt. Am 11. November 2006 ist er tot. Bestialisch gefoltert über Stunden und dann umgebracht von seinen drei Mithäftlingen. Sie wollten mal jemanden sterben sehen, Hermann sei halt ein Opfer, so ihre Aussagen.
Es war wieder einer von uns, der nicht überlebte. Und es geschah in meiner allerersten Literaturwerkstatt. Da die damalige Gefängnisleitung nicht den Namen des ermordeten Jungen herausrückte, wusste ich über einen längeren Zeitraum nicht, ob die Täter oder das Opfer in meiner Gruppe waren. Für die Angehörigen der Inhaftierten muss es eine grausame Zeit gewesen sein. Ich erinnere mich an weinende Eltern am Gefängnistor.
Was möchte ich Ihnen mit diesen zwölf kurzen Geschichten sagen? Ich will damit zeigen, dass wir alle im Leben Menschen brauchen, die uns beschützen. Erinnern sie sich an meinen Lieblingssatz aus meinen Literaturwerkstätten? Er lautet: Die uns schützen, sind die Engel. Das stimmt. Aus Marx wäre nie ein großartiger Philosoph geworden hätte er keinen Engel gehabt. Meine Engel fand und finde ich bei guten Katholiken und hilfsbereiten Kommunisten. So groß ist der Unterschied ja nicht.
Mirijam Günter