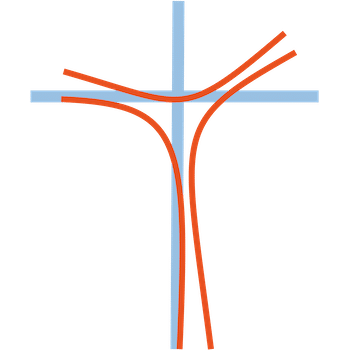Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas: Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tibérius; Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrárch von Galiläa, sein Bruder Philíppus Tetrárch von Ituräa und der Trachonítis, Lysánias Tetrárch von Abiléne; Hohepriester waren Hannas und Kájaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharías. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesája geschrieben steht: Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.
Liebe Schwestern und Brüder: Es war im sechsten Jahr der Präsidentschaft von Harry S. Truman; Winston Churchill war Premierminister von Großbritannien, Konrad Adenauer deutscher Bundeskanzler, Charles de Gaulle regierte in Frankreich und Josef Stalin in der Sowjetunion, Pius XII war Papst in Rom: da erging der Auftrag eines amerikanischen Geistlichen an den deutschen Schriftsteller Thomas Mann, und er zog in eine Kirche in Los Angeles, um dort das Wort Gottes zu verkündigen, und er verkündete es mit der Stimme eines Rufers in der Wüste.
Die Stimme eines Rufers in der Wüste: Genau so dürfte sich Thomas Mann tatsächlich gefühlt haben, als er 1951 zum einzigen Mal in seinem Leben eingeladen wurde, eine Predigt zu halten. Über diese Predigt möchte ich heute predigen. Dazu muss ich zunächst mit Ihnen ein Jahrzehnt zurückgehen. Ein Rufer in der deutschen Wüste war Thomas Mann schon lange gewesen, etwa im Januar 1942, als er sich aus Amerika an die deutschen Radiohörer wandte, die sich trauten, den „Feindsender“ BBC einzuschalten. „Deutsche Hörer“, so sagte er da, „die Nachricht klingt unglaubwürdig, aber meine Quelle ist gut. In zahlreichen holländisch-jüdischen Familien … herrscht tiefe Trauer um Söhne, die eines schaurigen Todes gestorben sind. Vierhundert junge holländische Juden sind nach Deutschland gebracht worden, um als Versuchsobjekte für Giftgas zu dienen. … Die Geschichte klingt unglaubwürdig, und überall in der Welt werden viele sich sperren…, sie für menschenmöglich zu halten.“ Dies alles bedeute „die Abschaffung aller sittlichen Errungenschaften des Menschen seit Jahrtausenden … auch der mildernden, sittigenden, das menschliche Gewissen schärfenden Wirkungen des Christentums.“
Thomas Manns Weihnachtssendung im selben Jahr 1942 setzt das fort. „Der Judenterror“ ist sie überschrieben, und sie beginnt so: „Man wüsste gern, wie ihr im Stillen von der Aufführung derer denkt, die in der Welt für euch handeln. Der Judengreuel in Europa zum Beispiel, wie euch dabei als Menschen zumute ist, das möchte man euch wohl fragen. … Jetzt ist man bei der Vernichtung, dem … Entschluss zur völligen Austilgung der europäischen Judenschaft angelangt.“ Dann wird Thomas Mann so konkret, wie es unter seinen schwierigen Kommunikationsumständen möglich ist: „In Paris wurden binnen weniger Tage 16 000 Juden zusammengetrieben, in Viehwagen verladen und abtransportiert. Wohin?“
Erst am 14. Januar 1945 kann er diese Frage beantworten: „Weißt du, der mich jetzt hört, von Maidanek bei Lublin in Polen, Hitlers Vernichtungslager? Es war kein Konzentrationslager, sondern eine riesenhafte Mordanlage. Da steht ein großes Gebäude aus Stein mit einem Fabrikschlot, das größte Krematorium der Welt. … Vom 15. April 1942 bis zum 15. April 1944 sind allein in diesen beiden deutschen Anstalten [Maidanek und Birkenau] 1 715 000 Juden ermordet worden. Woher die Zahl? Aber eure Leute haben Buch geführt, mit deutschem Ordnungssinn! … Buch geführt haben diese Verblödeten auch noch über das Knochenmehl, den aus diesem Betrieb gewonnenen Kunstdünger. Denn die Überreste der Verbrannten wurden gemahlen und pulverisiert, verpackt und nach Deutschland geschickt zur Fertilisierung des deutschen Bodens, – des heiligen Bodens, den deutsche Heere danach noch verteidigen zu müssen, verteidigen zu dürfen glaubten gegen Entweihung durch den Feind! … Deutsche, ihr sollt es wissen.“
Die deutschen Hörer wollten es nicht wissen. Bis weit in die Nachkriegszeit hinein galt ihnen der Exilierte als Volksfeind und Verräter, als Handlanger der Alliierten und wie die Beschimpfungen sonst noch lauteten. Er hätte es ich sehr viel leichter machen können. Aber er hatte das Empfinden, dass ihm keine andere Wahl blieb: dass er reden musste. Dass ihn bei einer Rückkehr nach Deutschland schon seit der Machtübernahme Hitlers ein „Schutzhaftbefehl“ erwartet hätte, unterschrieben von Heydrich, erfuhr er erst im Nachhinein. Bis in die jüngste Zeit, bis zu Sonja Valentins Buch Steine in Hitlers Fenster sind auch unter Thomas-Mann-Lesern diese Radioansprachen kaum gewürdigt worden. Dabei zogen sie doch nur die politisch-praktischen Konsequenzen aus dem großen biblischen Joseph-Roman. Was dort literarisch und theologisch virtuos entfaltet war, das wird hier zu einer politischen Agitation im Ton biblisch-prophetischer Rede: „die heilige Notwehr der Menschheit“ wird ausgerufen gegen Hitler als „die gottloseste aller Kreaturen, das schlechthin Teuflische“: „Der“, so ruft Thomas Mann aus, „ist besiegelt, glaubt mir, und fürchtet euch nicht!“
Auch der Deutschland-Roman vom Doktor Faustus über den Teufelspakt der deutschen Kultur mit dem Nationalsozialismus beruht auf der Kontrastierung des nationalsozialistischen Satanskultes mit den „gewissenschärfenden Wirkungen des Christentums“. Am berühmten Romanende steht da ein ganz einfaches, erschütterndes Gebet: „Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei euerer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.“
Christlich argumentierte Thomas Mann da, aber nicht kirchlich. Erst im kalifornischen Exil hat er, zum ersten und letzten Mal in seinem Leben, eine kirchliche Organisation gefunden, die ihm zu einer Art geistiger Heimat wurde. Es war die First Unitarian Church of Los Angeles. „Unitarians“: diese ursprünglich aus radikalen Strömungen der Reformationszeit hervorgegangene Bewegung war in Amerika seit dem 19. Jahrhundert zu einer humanistischen, überkonfessionellen und überreligiösen, universalistischen Bewegung geworden, tapfer engagiert im Kampf gegen Sklaverei und Rassentrennung und für eine soziale Demokratie. Der umstrittene und populäre, dezidiert linke unitarische Pastor Stephen Fritchman in Los Angeles hatte bereits seit 1938 gegen faschistische Bewegungen in Europa und den USA, auch bei Sympathisanten in den Kirchen angekämpft, und seit 1950 wurde er ein Wortführer der Linken gegen die McCarthy-Hysterie. Dieser Mann genoss von Anfang an Thomas Manns Vertrauen. Ihn lud er in sein Haus in Pacific Palisades ein; mit ihm arbeitete er intensiv zusammen; ihn nannte er vertraulich seinen Freund „Fritch“. Dass beide vom FBI beobachtet wurden, wussten sie da noch nicht.
Doch so sehr Fritchmans Öffnung seiner Gemeinde für Protestanten und Katholiken, für liberale Juden und Muslime, Buddhisten und atheistische Humanisten dem religiösen Weltbürger Thomas Mann gefiel, so entschieden bestand er auf der christlichen Herkunft und Prägung auch der Unitarier. Nachdrücklich verwies er auf seine eigene Prägung durch einen lutherischen Kulturprotestantismus. Und eine erstaunlich vehemente Sympathie zeigte er für einen humanistisch verstandenen Katholizismus, in dessen Traditionsverständnis er Menschheitstraditionen aufgehoben sah, die älter waren als das Christentum. Als ihm 1948 die lang gewünschte persönliche Audienz bei Papst Pius XII. gewährt wurde, da beugte er, seinem Tagebuch zufolge, „ohne die leiseste innere Hemmung das Knie vor Pius XII. und küßte den Ring des Fischers“.
Angesichts dieser Vorgeschichte ist es nicht verwunderlich, dass Fritchman seinen Freund und Mitstreiter Thomas Mann im März 1951 zu einer Predigt einlud. Und Thomas Mann nahm die Einladung an. Schon seine ersten Sätze auf Fritchmans Kanzel lassen keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm mit diesem Ort ist: „Ich bin Lutheraner und verdanke der deutschen protestantischen Tradition, in die ich hineingeboren wurde, viel. Aber immer war ich geneigt, in der Religion etwas Größeres und Weiteres, etwas allgemein Ethisches zu sehen als das, was sich in den Grenzen irgendeines Dogmas erfassen lässt.“
Nicht auf das Dogma kommt es diesem Prediger an (dessen Ansprache ich hier mit einigen Kürzungen zitiere), sondern auf die tätige Liebe: auf praktische Hilfe wie die, die er selbst und seine Familie den Unitariern verdankten, die unter anderem seinem Bruder Heinrich und seinem Sohn Golo zur Flucht aus Europa verholfen hatten. Dies bringt Thomas Mann nun auf einen anschaulichen Begriff. Seit die Nazi-Greuel überhand nahmen, sei ihm das Wort „unitarisch“ gleichbedeutend geworden mit ganz weltlichen Wohltaten, „gleichbedeutend mit Ausdrücken wie ‚Flüchtlingshilfe‘, ‚Entkommen‘, ‚Sicherheit‘. Bald bedeutete es, in Amerika und anderen Teilen der Welt, auch ‚Umverteilung‘, ‚Wiederaufbau‘, ‚medizinische Unterstützung‘,‚Kinderfürsorge‘, ‚Wohnungsbeihilfe‘ oder, mit einem Wort, angewandtes Christentum.” Angewandtes Christentum, applied Christianity – Thomas Mann hätte hier auch das Wort Jesu zitieren können, wonach wir alles, was wir den ärmsten seiner Geschwister getan haben, ihm selbst getan haben, ob wir es nun wussten oder nicht.
Was Thomas Manns Predigt ausspricht, das ist für sein literarisches wie für sein publizistisches Werk dieser späten Jahre programmatisch – für seine Essays und Radioansprachen ebenso wie für den Joseph und den Faustus. Mit der Leidenschaft und der Klarheit eines lange durchdachten Bekenntnisses spricht Thomas Mann aus, wo für ihn der Schnittpunkt von Literatur, Politik und Glaube liegt. Er tut das auf der Grundlage einer theologischen Überzeugung, die man leicht überhört. Nicht zufällig erinnert sie an den großen Theologen Paul Tillich. Denn in dessen Chicagoer Seminar hatte Thomas Mann diese Gedanken zum ersten Mal vorgetragen. Was heute nötiger sei als je zuvor, so wiederholt er, sei „angewandte Religion, angewandtes Christentum“ – und zwar in welcher Weise? Thomas Mann: „verehrungsvoll geneigt vor dem Geheimnis am Grunde aller menschlichen Existenz, das niemals gehoben werden kann und wird – denn es ist heilig.“ („honoring, and bowing in reverence to, the secret which lies at the bottom of all human existence and which must and will never be lifted, – for it is holy.“)
Deutlicher als hier hat Thomas Mann vielleicht nie formuliert, dass für ihn das religiöse Bekenntnis mit dem humanistischen nicht einfach zusammenfällt, sondern ihm vorausgeht. In einer demonstrativ überkonfessionellen Ehrfurcht verstummt dieser Prediger vor dem Allerheiligsten, das ihm doch Urheber und Grundlage alles Weiteren ist. Nirgends weist er ausdrücklich auf die Heilige Schrift hin. Aber sein Sprachgebrauch ist durchtränkt von der Bibel, imprägniert von prophetischer Rede: „es ist später, als manche von uns meinen“, wir halten fest an der „Hoffnung gegen alle Hoffnung” und kämpfen „den guten Kampf … gegen die Mächte der Finsternis“.
In seiner Autobiographie hat Pastor Fritchman sich sechsundzwanzig Jahre später an diese Predigt erinnert. Er nennt sie kurzweg „die eindrucksvollste Kanzelrede meiner gesamten Zeit als Pastor in Los Angeles“. Denn „Dr. Mann’s kurze Ansprache“, schreibt er, „half uns, das Konzept von Religion zu bestimmen, das wir damals in Umlauf bringen wollten.“ Schon in seiner Trauerrede zum Tod des Freundes im September 1955 hatte er in seiner Kirche gesagt: „Mit der Hingabe eines Heiligen, ja wie ein Prophet des Alten Testaments, ein Ezechiel oder Jeremia, erkämpfte er sich ein manchmal großartiges, wenn auch für manche Leute absurdes Vertrauen in die Anlagen der Menschheit.“ Und: „Er gab uns allen Stärke und Mut, Freude und Stolz auf unsere begrenzten menschlichen Möglichkeiten.“
Der Schriftsteller als Prophet? Ja, allerdings – meint Fritchman. Nicht weil er sich diese Rolle etwa angemaßt, weil er sie gesucht hätte. Sondern weil sie ihm zufiel. Weil sein Gewissen ihm die Verantwortung vorhielt, das auszusprechen, was er als Wahrheit erkannt hatte. The Order of the Day, so nannte er eine amerikanische Sammlung seiner politischen Essays und Reden, Der Befehl des Tages. Diesen Befehl, liebe Schwestern und Brüder, können wir alle hören, jeder und jede von uns. Aber werden wir ihm auch so mutig folgen wie Thomas Mann?
„Bereitet den Weg des Herrn!“ sagt die Stimme dieses Rufers in der Wüste. „Macht gerade seine Straßen!“ Tut es im Widerstand gegen jede Form des Faschismus, im Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Wohnungshilfe, Kinderfürsorge, Flüchtlingsunterstützung. Tut es im Vertrauen auf das große Geheimnis, aus dem alles Leben und alle Liebe kommt. Denn „Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.“
Vielleich haben Sie heute Tiefsinnigeres erwartet über den Autor des Joseph, des Faustus und der Heiligenlegende vom Erwählten anstelle dieser Gemeinplätze. Vielen Zeitgenossen, die den Dichter Thomas Mann bewunderten, wurde der gleichnamige Aktivist, der Moral-Apostel, zum Gespött. Er selbst hat dieses Problem thematisiert, in der Library of Congress. 1943 kam er dort in einer Rede auf seine vermeintlichen „Trivialitäten“ zu sprechen: „Mir ist es vorgekommen, daß, wenn ich irgendwo in den amerikanischen Staaten über Demokratie gesprochen und mich zu ihr bekannt hatte, ein high-brow Journalist … schrieb, ich hätte ‚Mittelstandsideen‘ geäußert. Was der high-brow Journalist mit diesem Wort bezeichnet, ist ja freilich nichts anderes als der Ideen-Komplex von Freiheit und Fortschritt, humanitarianism, Zivilisation … Es ist ein entsetzlicher Anblick, wenn der Irrationalismus populär wird. Die besseren Geister wissen, dass das wirklich Neue in der Welt, dem zu dienen der lebendige Geist berufen ist, etwas ganz anderes ist, nämlich die soziale Demokratie und ein Humanismus, der … wieder den Mut hat zur Unterscheidung von Gut und Böse.“
So, liebe Schwestern und Brüder, reden die Propheten, wenn das Wort Gottes an sie ergangen ist. Ezechiel und Jeremia reden so, der Täufer Johannes und, wenn es nach Fritchman geht, der Prophet Thomas Mann. Gleich in welcher Sprache und in welcher Kirche sie reden, sie trauen Menschen zu, den Weg zu bereiten; und sie fordern sie im Namen des Herrn auf, das mit allen Kräften zu tun. Aber der auf diesem Weg zu uns kommt und sein Reich verwirklicht, ist am Ende er allein, der Herrscher und Erbarmer der Welt, in seinem großen Advent. Vor ihm faltet auch dieser Prophet seine Hände und spricht: „Gott sei eurer armen Seele gnädig.“ –
„Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.“ Amen.