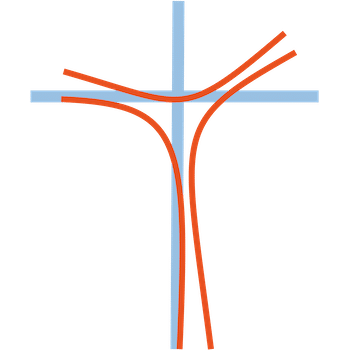Am vergangenen Donnerstag fand im Gemeindesaal von St. Canisius eine weitere Veranstaltung der Reihe „Zumutung Demokratie – Mut zur Demokratie“ statt. Gut 40 Gäste waren gekommen, um den Ausführungen von Prof. Dr. Ottmar Edenhofer zuzuhören, einem der weltweit einflussreichsten Experten für die Ökonomie des Klimawandels.
Ottmar Edenhofer, Jahrgang 1961, ist Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) sowie Professor an der Technischen Universität Berlin. International bekannt wurde er als Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe III des Weltklimarats IPCC, die sich mit Möglichkeiten der Emissionsminderung und globalen Klimapolitik beschäftigt. Seine Arbeit schlägt eine Brücke zwischen Naturwissenschaft, Ökonomie und Politik – und genau diese Perspektiven verband er auch in seinem Vortrag.
Zu Beginn stellte Edenhofer klar, dass wir uns nicht in einer einzelnen Krise befinden, sondern in einer Doppelkrise: Dem Klimawandel steht ein ebenso dramatischer Verlust an Biodiversität zur Seite. Edenhofer machte deutlich, dass beide Entwicklungen eng miteinander verbunden sind und nicht isoliert gelöst werden können. Er widersprach der verbreiteten Vorstellung, fossile Energieträger seien bald erschöpft, vielmehr seien Kohle, Öl und Gas noch für etwa zwei Jahrhunderte verfügbar. Das eigentliche Problem bestehe darin, sie trotz vorhandener Reserven im Boden zu belassen, wenn die Erderwärmung begrenzt werden soll. Klimaschutz sei deshalb keine Frage der Verknappung, sondern der politischen Steuerung.
Zum ersten Mal in der Geschichte stehe die Menschheit vor der Aufgabe, globale Gemeingüter – Atmosphäre, Ozeane, Artenvielfalt – gemeinsam zu bewirtschaften und zu schützen. Diese Herausforderung sei politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich beispiellos. Edenhofer knüpfte dabei an das bekannte Modell von der „Tragik der Allmende“ an, das beschreibt, wie gemeinschaftlich genutzte Ressourcen durch individuelle Interessen übernutzt werden. Als Gegenentwurf stellte er die Forschung von Elinor Ostrom vor, die gezeigt hat, unter welchen Bedingungen gemeinschaftliches Handeln funktionieren kann: klare Regeln, verlässliche Kooperation und Verantwortungsübernahme.
Einen zentralen Gedanken formulierte er mit dem Satz: „Individuelle Schlauheit führt zu kollektiver Dummheit.“ Was kurzfristig im Eigeninteresse liegt – etwa billige Energie oder politische Bequemlichkeit – kann langfristig katastrophale Folgen haben, wenn alle so handeln. Warum es trotzdem so schwer ist, zu globalen Lösungen zu kommen, illustrierte er anhand von zehn sogenannten „Unmöglichkeitstheoremen“. Sie zeigen, dass internationale Kooperation oft an Machtasymmetrien, fehlender Verbindlichkeit, unterschiedlichen Interessen, Misstrauen oder kurzfristiger Vorteilssicherung scheitert. Dennoch, so Edenhofer, seien solche Barrieren nicht naturgegeben, sondern politisch gestaltbar.
Als Ausweg skizzierte er zwei zentrale Konzepte. Das erste ist das Prinzip des „Fair Share“: Nur wenn sich die Lasten einer ambitionierten Klimapolitik gerecht und transparent verteilen lassen, können Staaten, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen. Edenhofer machte deutlich, dass Solidarität keine moralische Kür, sondern eine politische Notwendigkeit ist. Zudem unterstrich er die Bedeutung sogenannter „Netto-negativ-Emissionstechnologien“: Ohne Verfahren, die CO₂ aktiv aus der Atmosphäre entfernen – von Aufforstung bis zur technischen Speicherung – sei das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens kaum noch erreichbar.
Im abschließenden Ausblick betonte Edenhofer, dass die Lösung der ökologischen Krisen weder durch Wahlsprüche noch durch Verzichtsrhetorik erreichbar sei, sondern nur durch Innovationskraft, internationale Kooperation und politisches Rückgrat. Demokratie müsse sich als handlungsfähig erweisen, nicht trotz, sondern gerade wegen der globalen Dimension der Herausforderung.
Der Abend machte deutlich: Klimapolitik ist nicht nur eine ökologische oder ökonomische Frage, sondern eine zutiefst demokratische. Besonders angesichts der aktuellen Angriffe auf das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – etwa durch Vertreter der AfD, die seine Arbeit diffamieren und sogar mit einer Schließung drohen – wird deutlich, wie wichtig eine wachsame und wehrhafte Demokratie ist. Wissenschaftsfreiheit und faktenbasierter Diskurs sind Grundpfeiler demokratischer Auseinandersetzung. Die Beiträge aus dem Publikum zeigten, wie sehr Edenhofers Gedanken die Zuhörer bewegt haben und wie groß der Wunsch ist, diese „Zumutung Demokratie“ als Gestaltungsauftrag zu verstehen.