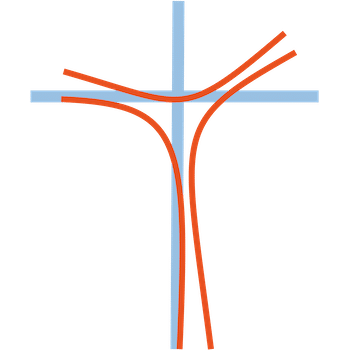Gedanken zu einer Veranstaltung, die nachdenklich machte
Bevor ich die Leserinnen und Leser mitnehme in meine protestantische Gedanken-und Gefühlswelt zu dieser Veranstaltung – ja, sie haben richtig gelesen, ich bin Protestantin – hier erst einmal die Eckdaten dessen, was sich im Folgenden als ein emotional tiefgehender und anrührender Abend entpuppte: Am 07.05.2024 lud der Katholische Deutsche Frauenbund zu einer Diskussionsrunde. Esther Göbel, Pastoralreferentin und Mitbegründerin der „Synodalen Gemeinde Berlin“ sowie Sibylle Rooß, Gemeinderatsmitglied in „Heilig Geist“, gaben an diesem Abend den Anwesenden im Gemeindesaal von Sankt Canisius einen Überblick über den aktuellen Stand des Reformprojektes „Synodaler Weg“. Dabei stand das erste Drittel der ca. 2-stündigen Veranstaltung im Lichte grundlegender Informationsvermittlung: Aufbau und Struktur des Projektes, Besetzung und Finanzierung der einzusetzenden Gremien sowie ein Überblick über den aktuellen Stand der sich in der Umsetzung befindlichen Beschlüsse ebenso wie die weitergehenden Ziele und Vorhaben.
Im Anschluss an den eher etwas „technisch“ wirkenden Informationsteil gab es dann Gelegenheit für Nachfragen sowie einen Austausch von Gedanken und Erfahrungen. Dieser Teil der Veranstaltung sollte sich im Rückblick als das bewegende Herzstück dieses Abends herausstellen, der mich nicht nur nachdenklich, sondern auch emotional angerührt und teilweise betroffen gemacht hat und mich noch Tage später innerlich beschäftigte.
Es folgten unter anderem Erzählungen von erlebter und gelebter Gemeindearbeit und den menschlichen Beziehungen, die diese prägen. Geschichten, die von jahrelangem persönlichem Engagement erzählen, wo Kirche im besten Sinne zu dem wurde, was sie sein sollte: Ein sicherer und stabiler Anker im Leben ihrer Mitglieder, der hält und trägt, den Menschen zugewandt, Glaubensheimat und gelebte Gemeinschaft.
Wo jedoch dieser Anker zerbricht, Vertrauen enttäuscht und Heimat verloren geht, hinterlassen solche Erfahrungen Schmerz, Enttäuschung und in letzter Konsequenz natürlich auch Frustration und inneren Rückzug. Die Berichte der Teilnehmenden sprachen aufrichtig Bände von dem tief empfundenen Schmerz darüber, wenn nach Jahren und Jahrzehnten eine solche Heimat verloren geht und man vor einem Neuanfang in einer anderen Gemeinde steht, weil klerikale Alleinentscheidungsgewalt das Durchtrennen gewachsener Gemeindeverbindungen ermöglicht, nur weil die Vorstellungen über die Gestaltung von Gemeinde auseinandergehen. Zurück bleibt in diesen Fällen das nachvollziehbare Gefühl von Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein.
Was nun wie eine protestantische „Abrechnung“ mit der katholischen Amtskirche im Allgemeinen und ihren priesterlichen Würdenträgern im Besonderen erscheint, soll es mitnichten sein.
Denn natürlich gibt es ebenso diejenige katholische Kirche und Gemeinden in eben jener, wo sich Pfarrer und Gemeinde trotz unterschiedlicher Rollen auf Augenhöhe begegnen, den jeweils anderen wahrnehmen und somit Vertrauen und echte Gemeinschaft erwachsen kann. Dort ist Gemeinde mehr als ein Ort von klerikaler Sakramentsverwaltung – dort wird Gemeinde zur Heimat.
Vor diesem gedanklichen Hintergrund bekommt die Diskussion über Synodalität eine zutiefst menschliche Dimension, die ich an diesem Abend im Gemeindesaal von Sankt Canisius erleben durfte. Es wurde deutlich, dass es bei Synodalität eben nicht um die Umkehrung von Machtverhältnissen geht, sondern eben um jenes Ankommen auf Augenhöhe, wo Wahrheit nicht diktiert, sondern im gegenseitigen Austausch um sie gerungen wird. Und das meint selbstverständlich nicht das „Abstimmen“ über zentrale Glaubensinhalte, wie Kritiker der synodalen Idee immer wieder vorbringen, sondern das ernsthafte und gleichberechtigte Gestalten von Kirche und Gemeinde, wo Menschen nicht nur in ihren Anliegen, sondern vor allem auch mit ihren mitgebrachten Fähigkeiten angenommen und vor allem ernst genommen werden und ein echtes Miteinander möglich wird.
Trotz aller nachdenklichen Momente gibt es natürlich nicht nur Grund zum Klagen, sondern auch Funken der Hoffnung. Dort, wo sich Kleriker und Gläubige nicht einfach mit dem Status quo abfinden, sondern sich beständig weiterhin für die Menschen in ihrer Kirche und die Kirche selbst einsetzen, damit sie zu einer gerechteren Version ihrer selbst werden kann. Dies wünsche ich meinen katholischen Brüdern und Schwestern von Herzen und hoffe, dass der Synodale Weg den Funken dieser Hoffnung weitertragen kann, damit aus ihm ein Leuchtfeuer wird, das so dringend gebraucht wird.
Ecclesia semper reformanda est – die Kirche muss beständig reformiert werden
In diesem Sinne: Auf geht’s
Berenike Kampmann